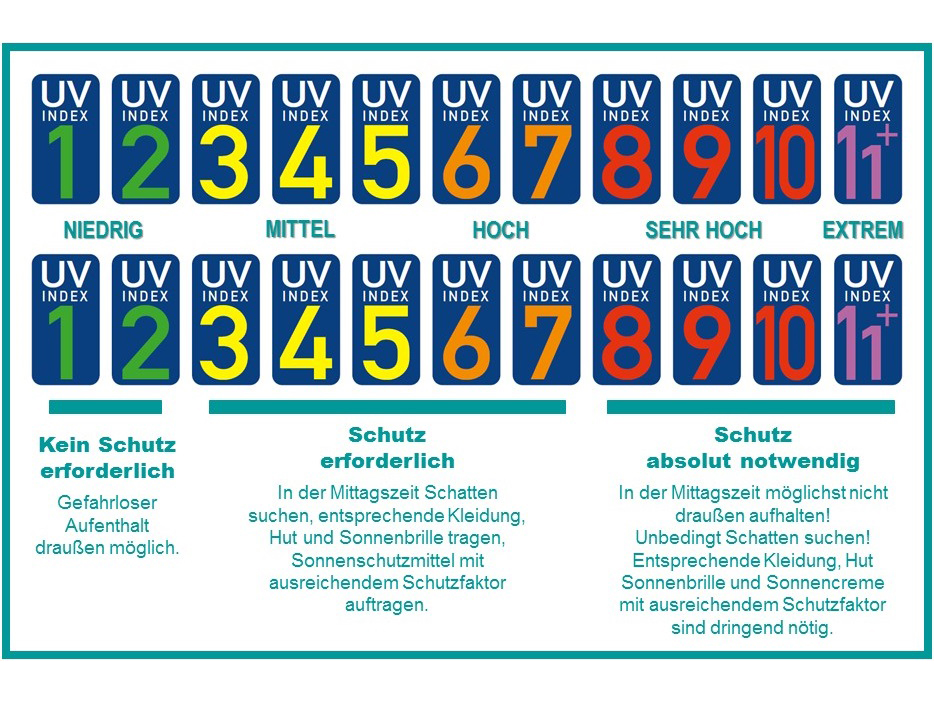Kinder psychisch kranker Eltern: Einblick in die Arbeit der Landesfachstelle KipsFam MV
Hallo Frau Dr. Pomowski, danke, dass Sie sich Zeit für den Blog nehmen. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Mein Name ist Kristin Pomowski, ich bin studierte Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin und habe bereits bei meinem Berufseinstieg 2005 mit Familien zusammengearbeitet, in denen psychische Erkrankung eine Rolle spielten. In der Sozialpädagogischen Familienhilfe habe ich Eltern mit psychischen Erkrankungen begleitet und mit ihnen auf die Situation ihrer Kinder geschaut.
Fast alle Kolleginnen in unserer Landesfachstelle haben in ihrem beruflichen Alltag mit der Thematik Berührung gehabt. Da wir alle aus unterschiedlichen Berufskontexten kommen, bringen wir unsere spezifische Erfahrungen mit den jeweiligen Versorgungs- und Unterstützungssystemen in unsere Arbeit ein.

Quelle: Privat
Seit wann gibt es das Projekt KipsFam MV und was verbirgt sich dahinter? Was sind die Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte?
Die Landesfachstelle KipsFam wurde Anfang 2023 vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport MV initiiert. Sie ist beim Landesverband Sozialpsychiatrie MV e.V. angesiedelt und wird mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds ESF+ gefördert (vorerst bis Dezember 2025, mit Option auf Verlängerung bis Ende 2028).
Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche aus psychisch und/oder suchtbelasteten mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert sind und daher ein vielfach erhöhtes Risiko haben, selbst psychisch zu erkranken. Allerdings sind sie oft sehr angepasst, still und kaum sichtbar – psychische Erkrankungen sind nach wie vor mit einem großen Stigma belastet. Die Familien nehmen kaum Hilfen in Anspruch und sind daher für die Versorgungs- und Unterstützungssysteme schwer erreichbar. Die betroffenen Familien dürfen aber nicht allein gelassen werden.
2019 haben wir in einer Bestandsaufnahme festgestellt, dass es in MV an wohnortnahen, altersgerechten, niedrigschwelligen und digitalen Anlaufstellen für Kinder aus psychisch und/oder suchtbelas-teten Familien mangelt. Besonders auf dem Land. Die Wege sind lang und die Verfahren starr, wofür die Kraft der Familien oft nicht ausreicht. Jetzt wollen wir unterschiedliche Akteur*innen zusammenbringen und gemeinsam neue Ansätze entwickeln. Unser Ziel ist es, langfristig in allen acht Gebietskörperschaften familienorientierte und leicht zugängliche Angebote zu haben und so die Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendlichen in MV nachhaltig zu verbessern.
Was können Kinder tun, wenn sie bemerken, dass ihre Eltern süchtig sind?
Eine Sucht ist eine psychische Erkrankung und kann verschiedene Gesichter haben. Manche Menschen trinken zu viel Alkohol oder nehmen andere Drogen zu sich. Andere leiden an Essstörungen (Bulimie, Magersucht etc.) oder Spielsucht. Daher ist es auch unterschiedlich, wie die Eltern sich verhalten und woran man ihre Sucht erkennen kann. Nicht immer ist es offensichtlich, weil der Atem beim Gute Nacht-Kuss nach Alkohol riecht oder überall Schnapsflaschen rumliegen.
Wichtig ist: Wenn Kinder vermuten, dass ihre Eltern süchtig sind und Hilfe benötigen, sollten sie sich jemandem anvertrauen. Es ist nicht ihre Aufgabe, für das Wohlergehen der Eltern zu sorgen. Andere Erwachsene, die von einer möglichen Sucht oder psychischen Erkrankung in der Familie wissen, können weitere Unterstützung holen. Und den Kindern zeigen: Es ist nicht ihre Schuld, wenn es Mama oder Papa im Moment nicht gut geht – es gibt Fachpersonen, die helfen können.
Auf unserer Homepage www.blickauf-kipsfam.de geben wir u.a. Tipps, an wen Kinder, Jugendliche und Eltern sich wenden können, um Beratung und Hilfe zu erhalten. Wir zeigen auch, wie sie wieder etwas mehr Normalität in ihren Alltag holen können.
Wie geben Sie Unterstützung und Hilfe?
Die Landesfachstelle ist keine klassische Beratungsstelle für betroffene Familien, sondern Vernetzerin und Beraterin in der Region. Wir möchten Akteur*innen im Bundesland begleiten, zusammenbringen und so neue Unterstützungsangebote fördern. Oft fehlt es Fachkräften an Hintergrundwissen über Beantragung- und spezifischen Unterstützungsmöglichkeiten – dabei möchten wir zur Seite stehen.
Das Thema KipsFam ist ein Schnittstellenthema, es ist also notwendig, Akteur*innen aus verschiedenen Sektoren (Gesundheitswesen, Bildung, Freizeit, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe etc.) an einen Tisch zu bringen. Die Landesfachstelle selbst ist auch intersektoral aufgebaut: Die Fachaufsicht ist an das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport MV gekoppelt und dort an zwei ver-schiedenen Referaten angesiedelt (Psychiatrie, Maßregelvollzug, Sucht und Prävention & Jugendhilfe, Jugendarbeit, Kinder und Jugendschutz). Durch die unterschiedlichen Professionen vereinen wir die Perspektiven der Sozialpsychiatrie, der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Gesundheitsförderung und Prävention. Zudem gibt es weitere enge Kooperationspartner*innen auf Landesebene, zu denen ein enger Austausch besteht: Das GKV Bündnis für Gesundheit MV, die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV (LAKOST MV), die Unimedizin Rostock und Schabernack (Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V.). Aktuell werden in allen Landkreisen und kreisfreien Städten regionale Anlauf- und Unterstützungsstel-len gegründet – KipsFam Regio. Ihre Aufgabe ist es, Angebote vor Ort zu koordinieren und voranzubringen, das Thema sichtbar zu machen, sich zu vernetzen und für Familien ansprechbar zu sein.
Aufklärung ist bei psychischen oder Suchterkrankungen sehr wichtig. Wie fördern Sie die Prävention?
Psychische Erkrankungen können jede*n treffen. Mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit möchten wir das Stigma „psychisch krank“ abbauen. Mit verschiedenen Formaten wie Homepage, Social Media, Veranstaltungen, Newsletter usw. klären wir über Hintergründe und Hilfsangebote auf. Dabei möchten wir auch dafür sensibilisieren, im Falle einer psychischen Erkrankung die Kinder mitzudenken. Wenn Erwachsene beispielsweise wegen einer Depression in Therapie gehen oder in einer Klinik behandelt werden, sollte immer geprüft werden – Ist die Patientin Mutter? Hat der Patient Kinder? Sind sie versorgt? Das ist unser größtes Anliegen: Wir möchten diese Kinder und ihre Bedarfe sichtbar machen. Dazu zählt auch Früherkennung: Es muss sichergestellt sein, dass Belastungen in der Familie früh gesehen werden – sei es durch die Kinderärztin bei der U-Vorsorgeuntersuchung, den Trainer*innen im Fußballverein oder die Lehrkraft an der Schule. Das können wir nur erreichen, wenn alle Systeme aus den unterschiedlichen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen und Familien zusammenarbei-ten: Verwaltung, klinische Versorgung, Kinder- und Jugendhilfe, frühkindliche und schulische Bildung, Prävention und Gesundheitsförderung, Beratung und Therapie, Arbeit etc. – alle Institutionen sollen ihre Unterstützungsleistungen familienorientiert konzipieren und nicht nur die Einzelperson, sondern die gesamte Familie sehen. Daher wollen wir Fachkräfte aus unterschiedlichen Sektoren weiterbilden.
Wie erkennt man bei Kindern Anzeichen einer Belastung durch die Erkrankung der Eltern?
Eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung der Eltern belastet das gesamte Familiensystem, insbesondere die Kinder. Sie müssen in jungen Jahren elterliche Aufgaben übernehmen und sind oft seelisch überfordert. Wenn Eltern in psychischen Ausnahmezuständen und Krisen stecken, können sie die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht immer sehen. Die Kinder und Jugendlichen machen sich häufig Sorgen um ihre Eltern, fühlen sich schuldig oder schämen sich dafür, dass ihre Eltern so anders oder seltsam sind. Das führt zu Tabuisierung, Isolation, Überforderung und Stress.
Für Außenstehende ist diese Belastung oft nur schwer zu erkennen. Viele betroffene Kinder isolieren sich und vernachlässigen mehr und mehr ihre sozialen Kontakte. Besonders, wenn sie sich zuhause auch um jüngere Geschwister kümmern müssen, wirken die Kinder plötzlich müde oder unzuverlässig, die Leistungen in der Schule fallen ab. Auch sehr auffallendes, eventuell aggressives Verhalten können erste Anzeichen sein.
Wo ist KipsFam zu finden? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
Am einfachsten geht das über unsere Homepage: www.blickauf-kipsfam.de
Hier finden Hilfesuchende auch spezielle Angebote aus den einzelnen Region in MV. Wir vermitteln auch gerne zu Fachkräften, die sich vor Ort bereits mit dem Thema beschäftigen.
Einfach eine E-Mail schreiben – wir sind bemüht, so schnell wie möglich zu antworten und je nach An-liegen Informationen, Kontakte o. ä. zu vermitteln. Aktuelle Infos zu unserer Arbeit und zum Thema gibt es auch auf unserem Instagram-Account @blickauf_kipsfam und über unseren Fachnewsletter BlickPost: https://www.blickauf-kipsfam.de/newsletter