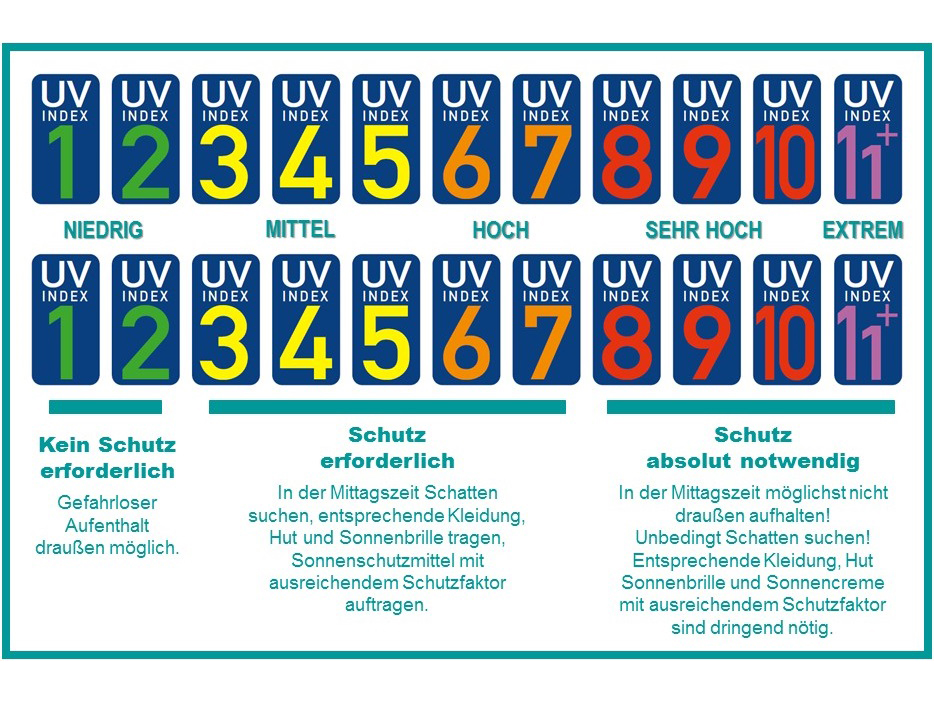Alkohol in der Schwangerschaft - Die Arbeit der FASD Beratungsstelle
Lassen Sie uns in diesem Blogartikel einen Blick auf das sensible Thema in unserem Bundesland werfen. Was macht eine FASD Beratungsstelle eigentlich? Was sind die Aufgaben bzw. Arbeitsschwerpunkte? Wie werden Betroffene bzw. Angehörige unterstützt, die Hilfe suchen? Wie wichtig ist Aufklärung?
Diese und noch weitere Fragen beantwortet Cornelia Kirsten von der FASD Beratung für Rostock & M-V.

Hallo Frau Kirsten, danke, dass Sie sich Zeit für den Blog nehmen. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Vielen Dank, dass ich die Beratungsstelle und mich hier vorstellen darf. Ich habe viele Jahre lang an der Uni Rostock ein Lektorat am Sprachenzentrum der Universität Rostock geleitet und Fremdsprachen unterrichtet. Da ich aber seit vielen Jahren Pflegemutter bin, darüber sehr viel Kontakt zum Thema FASD hatte, habe ich im vergangenen Jahr den Sprung gewagt. Mein eigenes Pflegkind hat FASD und die schlechte Versorgungslage für Menschen mit dieser Behinderung bewegt mich seit Jahren. So kamen die Rostocker Stadtmission e.V. und ich als Diplom-Pädagogin und FASD-Fachkraft zusammen und eröffneten im Oktober 2022 gemeinsam die Beratungsstelle für Rostock und das gesamte Bundesland. Ich bin Projektkoordinatorin und FASD-Fachberaterin und sehr glücklich in dieser neuen Tätigkeit.
Seit wann gibt es die FASD Beratungsstelle Rostock & M-V? Was sind Ihre Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte?
Die Beratungsstelle wurde am 01.10.2022 eröffnet und zwar nur einen Tag nach Zusage der Förderung durch die Aktion Mensch. Dort hatten wir unser Konzept eingereicht und werden für mind. 4 Jahre durch die Aktion Mensch mitfinanziert. Unsere Beratungsstelle hat sich ihrem Namen entsprechend vor allem Beratung auf die Fahnen geschrieben. Zu uns kommen Menschen mit FASD (und FASD-Verdacht), Familien alles Art mit Kindern mit FASD sowie Fachleute, vorrangig aus pädagogischen und therapeutischen Bereichen, die mit Kindern und Jugendlichen mit dieser Erkrankung bzw. Behinderung arbeiten.
Dazu machen wir Präventionsveranstaltungen in Schulen, Vorträge bei diversen Interessierten und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf FASD. Wir unterstützen Veranstaltungen, die direkt für Menschen mit FASD angeboten werden und bieten Fortbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte.
Wie geben Sie Unterstützung und Hilfe?
Im Präventionsbereich sind wir so wichtig, weil das vermeintliche Allgemeinwissen darüber, dass Alkohol in der Schwangerschaft schädlich für das ungeborene Kind sein kann, nicht wirklich gut verankert ist. Angesichts von 58% der deutschen Schwangeren, die Alkohol konsumieren und 44% der Deutschen, die nicht wissen, dass vorgeburtlich konsumierter Alkohol das Kind nahhaltig schädigen kann, ist Aufklärung für uns wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
In der Beratung ist das Zuhören das A und O, denn die Ratsuchenden hatten bisher keine fachlich kompetenten Ansprechpartner*innen in MV, die verstehen, wie das Leben mit FASD sich für alle Beteiligten anfühlt. Wir besprechen oft das Helfendennetzwerk und die Möglichkeiten, Unterstützungsangebote anzuzapfen, erklären die Behinderung und ihre Auswirkungen, intervenieren in Krisen z.B. mit Schule oder Arbeitgeber*innen, vermitteln Kontakte zu Diagnostikstellen, beraten bei Hilfeplan- und Teilhabegesprächen usw. Besonders wesentlich ist die Entlastung der Angehörigen, mit denen wir immer wieder schauen, wo dieser Angebote zu finden sind.
Aufklärung zu FASD ist sehr wichtig. Wie fördern Sie die Prävention?
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann zu fetalen Alkoholschäden führen und das Risiko wird aktuell noch sogar von Fachleuten massiv unterschätzt. Entscheidend ist, dass FASD absolut KEIN ausschließliches Problem suchterkrankter Frauen ist. Alle Frauen, die nicht ab Planung der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit bewusst abstinent sind, sind Risikogruppe. Bereits klein(st)e Mengen an Alkohol können das Ungeborene nachhaltig schädigen und dies von Beginn der Schwangerschaft an!
Wir sprechen mit Medien, wir gehen zu diversen Fachtagen, halten Vorträge – idealerweise in der Mitte der Gesellschaft, denn die FASD entsteht genau dort. Die hirnorganischen Schädigungen sind nicht sichtbar, zeigen sich oft nur in auffälligen Verhaltensweisen und darüber klären wir ebenso auf wie über die Entstehung der Behinderung.
Besonders wichtig sind uns Schulprojekte und Präventionsveranstaltungen, um die künftigen Generationen über die Risiken aufzuklären und für Vermeidung von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu sensibilisieren. Es macht unglaublich viel Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten, die Fragen und Diskussionen sind immer spannend. Wichtig ist die Nachhaltigkeit und Wiederholung unserer Botschaften, es geht um individuelle und gesamtgesellschaftliche Verantwortungsübernahme.
Wie erkennt man FASD bei Kindern? Welche Anzeichen gibt?
Grundsätzlich gilt FASD als unsichtbare Behinderung, da der Hirnschaden nicht äußerlich erkennbar ist. Unter der Überschrift FASD gibt es drei Diagnosen:
- FAS (fetales Alkoholsyndrom) zeigt sich in gewissen Gesichtsmerkmalen und kleinem Wuchs, dazu kommen die Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems durch den alkoholbedingten Hirnschaden. Alkohol ist ein Zellgift und geht ungehindert über die Plazenta zum Ungeborenen. Dort beeinflusst er die Entwicklung in unterschiedlichem Maße in Zusammenhang mit verschiedenen Einflüssen. Jedoch wirkt er immer auf das Gehirn, selbst in der Frühschwangerschaft schon. Alkohol löst Hirnzellen und die isolierende Fettschicht um Nervenbahnen auf, so dass weniger Hirnmasse da ist und die Weiterleitung von Nervenreizen z.T. massiv gestört ist. Dadurch entstehen Verhaltensbesonderheiten unterschiedlichster Art. Spätestens ab Schulalter zeigt sich oft die mangelnde Alltagskompetenz als Folge des vorgeburtlichen Alkoholkonsums.
- Beim pFAS (partiellen fetalen Alkoholsyndrom) gibt es einige wenige Gesichtsmerkmale, das Wachstum ist unbeeinflusst. Auffallend ist wiederum das Verhalten, jedoch braucht es für die Diagnose Wissen um den Alkoholkonsum der leiblichen Mitter.
- Die dritte Diagnose ist ARND (alkoholbedingte, entwicklungsneurologische Schädigungen), die sich nur noch im Verhalten zeigen. ARND ist komplett unsichtbar und leider gibt es mangels Auskunft über vorgeburtlichen Alkoholkonsum diese Diagnose nicht so oft, wie sie nötig wäre.
Wichtig ist, etwas simpel ausgedrückt: Hat ein Mensch Diagnosen, aber die indizierten Medikamente, Therapien und pädagogische Interventionen aus dem Standardspektrum greifen nicht – liebe Ärzt*innen fragt nach Alkohol in der Schwangerschaft. Es geht nicht um eine Stigmatisierung der Mütter!! Frauen wollen nicht bewusst ihre Kinder schädigen, aber diese Frage hilft, um Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Therapien für den Menschen zu finden.
Welche Auswirkungen hat FASD in den verschiedenen Altersstufen (Säugling, Kleinkind, Teenager, Erwachsener)?
Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Wir sprechen von einer Spektrumstörung mit 428 möglichen Symptomen, die individuell ausgeprägt sind. Säuglinge fallen oft durch Schluck- und Trinkschwierigkeiten und starke Regulationsstörungen sowie eingeschränkte Motorik auf. Laufen Kinder in der Kita oft noch mit, treten massive Schwierigkeiten häufig im Schulalter auf. Anforderungen sind trotz beispielsweise durchschnittlichem IQ oft zu hoch, da die sogenannten Exekutivfunktionen beeinträchtigt sind – also Handlungsplanung, Motivation, vorausschauendes Denken, Inhibition, geistige Flexibilität usw.
Menschen mit FASD verarbeiten Informationen oft stark verlangsamt und leiden nicht selten unter demenzähnlichem Vergessen. Häufig kommen ADHS, Autismus, Lese-Rechtschreibschwäche, Matheschwäche (Diskalkulie) und andere Diagnosen dazu, sind aber eigentlich Symptome von FASD.
Je älter die Menschen mit FASD werden, desto schwerer wird die Alltagsbewältigung, da Verselbständigung erwartet wird. Diese ist mit vielen Ausprägungen der Behinderung nicht möglich. 80% der Betroffenen sind als Erwachsene in einigen oder allen Lebensbereichen auf Betreuung und Unterstützung angewiesen und dies IQ-unabhängig! FASD ist nicht heilbar.
Können spezielle Therapien oder andere Unterstützungsmaßnahmen bei FASD unterstützend wirken?
Therapien können FASD nicht verändern, aber die Auswirkungen des Störungsbildes minimieren. Auch hier gilt: Kennst du Einen, kennst du Einen! Es muss immer auf die individuelle Ausprägung von FASD beim Menschen geschaut werden, um geeignete Therapien zu finden.
In jungen Jahren profitieren Menschen mit FASD oft von heilpädagogischer Frühförderung, Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Ergotherapie und körperbasierte, sinnesorientierte Psychotherapien greifen oft auch gut im Erwachsenenalter. Tiergestützte, naturtherapeutische Angebote können ebenfalls sehr hilfreich sein. Sport und die freie Natur wirken auch bei Menschen mit FASD unterstützend. Bei den Therapien geht es oft es um das Trainieren der Bedürfnis- und Grenzwahrnehmung, das Verstehen von Emotionen und Gefühlen.
Traumatherapie ist schwierig bei FASD, zumindest wenn sie stark kognitiv angelegt ist. Durch das demenzähnliche Vergessen und die stark eigeschränkte Sprachrezeption, also das gestörte Verstehen von Gesprächen und Zusammenhängen beispielsweise gibt es keine Fortschritte und macht ggf. die Lage für Einzelne noch schlimmer. Auch kognitiv angelegte Psychotherapien sind teilweise kritisch zu bewerten.
Im Erwachsenenalter empfiehlt sich Soziotherapie, aber davon gibt es deutlich zu wenig Angebote. Auch andere Therapieformen können hilfreich sein, diese sind aber teils selbst zu bezahlen.
Wichtig ist: auch medikamentöse Therapien haben ihre Berechtigung und können – gut überwacht und mit viel Aufklärung – den Leidensdruck beim Menschen mit FASD senken.
Welche Fragen werden Ihnen am häufigsten von Betroffenen, Familien bzw. Angehörigen gestellt?
Zuerst einmal kommt besonders im Erwachsenenbereich die Frage, wo die Diagnostik machbar ist und die Antwort ist: es ist sehr schwer und gibt kaum Stellen. Die Frage kommt auch im Kinder- und Jugendbereich, da profitieren wir in MV von der Rostocker Kinder- und Jugendpsychiatrie, die eine FASD Spezialsprechstunde anbietet. Aber auch andere MVZs und SPZs diagnostizieren in unserem Bundesland, wobei die Qualität unterschiedlich ist.
Die Menschen kommen tatsächlich aber weniger mit Fragen zu mir, als häufiger mit komplexen Problemlagen. Grundlage dieser Probleme ist (fast) immer mangelndes Wissen, Verständnis und wenig Bereitschaft in der Umwelt, sich mit dem Störungsbild FASD auseinanderzusetzen. Man lastet das auffällige Verhalten dem Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen an nach dem Motto: „Du bist faul, verweigerst dich, ignorierst, provozierst, störst usw. Du willst dir keine Mühe geben.“
Tatsächlich ist es aber kein Nicht-Wollen, sondern ein hirnorganisch bedingtes „Nicht-Können“, welches nur falsch interpretiert werden kann, wenn Kita, Schule, Ärzteschaft, Arbeitsplätze, Nachbar*innen, Freund*innen … die gesamte Gesellschaft nicht endlich FASD verstehen lernt.
Menschen mit FASD WOLLEN dazu gehören, sie wollen sich anpassen und gemocht werden, sie sind einfach Menschen! Leider macht die Behinderung dies oft schwierig, wenn das Umfeld nicht aufgeklärt ist. Die Gesellschaft muss sich anpassen, die Schule, die Arbeit. Denn Menschen mit FASD können diese Anpassungsleistung bei allem Wollen nicht vollbringen.
Kontaktaufnahme: Wo ist die FASD Beratungsstelle zu finden? Wer ist Träger der Beratungsstelle?
Wir sind auf vielfältigem Wege erreichbar. Die Rostocker Stadtmission e.V. als Träger der Beratungsstelle hat eine Website eingerichtet mit den wesentlichen Informationen: https://rostocker-stadtmission.de/fasd-beratungsstelle-m-v Wir beraten vor Ort, telefonisch und per Email sowie Videokonferenz.
Auch bei Social Media sind wir vertreten: www.facebook.com/FASDBeratungsstelleHROundMV oder www.instagram.com/fasd_beratungsstelle_mv/ Am schnellsten nehmen Sie über die Telefonnummer 0151 22420953 mit uns Kontakt auf oder per fasd@rostocker-stadtmission.de
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, sollten Sie Interesse an der Arbeit haben, Fortbildungswünsche oder Beratungsanliegen haben!
Vielen Dank für Ihre Zeit & Ihr Engagement!